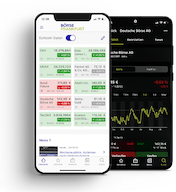Aus dem ETF-Magazin: "Neue Richtschnur aus Brüssel"

PAB und CTB: Immer mehr ETFs orientieren sich an zwei Vorgaben, mit denen die Europäische Union den Schadstoffausstoß der Unternehmen senken will. Was steckt dahinter?
März 2022. MÜNCHEN (ETF Magazin). Klima-ETFs erlebten 2021 einen Ansturm wie nie. Rund 8,4 Milliarden Euro an Neugeldern sind in Europa im vergangenen Jahr in Klima-ETFs geflossen, wie die Analysten der französischen Fondsgesellschaft Amundi berechneten. Damit haben sich die Zuflüsse in diese ETFs gegenüber 2020 nahezu verdoppelt. „Klima-ETFs waren die klare Nummer eins bei den Sektor- und Themen-ETFs“, berichtet Thomas Wiedenmann, ETF-Chef für Deutschland bei Amundi. Immer mehr Klima-ETFs würden inzwischen auch nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Damit seien diese ETFs quasi „dunkelgrün“, also Fonds, die nach den Vorstellungen der EU besonders gut für den Klimaschutz sind. Doch es geht immer noch mehr. Mit zwei weiteren Vorgaben beziehungsweise Orientierungsmaßstäben setzt die EU noch einen drauf.
Mehrere Anbieter haben ETFs aufgelegt, die diese neuen „Benchmarks“ (Vergleichsmaßstäbe) bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios berücksichtigen. Erkennbar sind diese Klima-ETFs an den Abkürzungen PAB oder CTB im ETF-Namen. Zu den ETF-Anbietern mit PAB/CTB-ETFs gehören Amundi sowie der kürzlich von Amundi übernommene Emittent Lyxor, ebenso wie BNP Paribas, Franklin Temp-leton, iShares, Deka und Tabula. Doch was genau hat es mit PAB und CTB auf sich? Vereinfacht gesagt, verdeutlichen die Kürzel, dass diese ETFs die EU-Referenzwerte für klimabedingten Wandel einhalten und sich dabei entweder an der neuen Paris Aligned Benchmark (PAB) der EU ausrichten oder an der Climate Transition Benchmark (CTB) der EU. Bei den PAB- und CTB-ETFs handelt es sich in erster Linie um Aktien-ETFs, vereinzelt auch um Anleihen-ETFs.
Das Ziel der EU ist, mit ihren beiden neuen Benchmarks Mindeststandards zu setzen, die Indexanbietern bei der Erarbeitung von Referenzwerten für klimafreundliche und auf die Pariser Klimaziele ausgerichtete Anlagen helfen sollen. Außerdem soll Anlegern im Dschungel der nachhaltigen Geldanlagen eine Orientierung geboten werden. „Die Kennzeichnungen sollen eine Entscheidungshilfe für Anleger sein, die in Unternehmen mit geringen CO2-Emissionen investieren wollen“, heißt es vonseiten der EU-Kommission. Genau zu diesem Zweck hatte die Kommission die bereits bestehende Benchmark-Verordnung überarbeitet. Die neue Version wurde im Dezember 2019 im Amtsblatt der EU-Kommission veröffentlicht und trat am 30. April 2020 in Kraft.
Gegen Green Washing
Sowohl PAB als auch CTB haben die sogenannte Dekarbonisierung zum Ziel. Konkret geht es um die Begrenzung des Treib-hausgasausstoßes gemäß dem Pariser Klimaabkommen von 2015, das vorsieht, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu limitieren. Um private Gelder in diese Richtung zu lenken, hatte die EU-Kommission 2018 eine technische Expertengruppe für nachhaltige Finanzen eingesetzt (Technical Expert Group on Sustainable Finance). Die Benchmarks sind ein Ergebnis der Arbeit dieser Gruppe. Mit PAB und CTB will die EU-Kommission also eine größere Transparenz und Vergleichbarkeit der Klimafonds herstellen und vor allem das Kapital der Anleger in klimafreundliche Investitionen umlenken.
Gleichzeitig sollen durch die Vorgaben Klima-Mogelpackungen der Fondsgesellschaften verhindert werden, bei denen die Fondsanbieter Umweltkriterien und Emissionswerte künstlich niedrig ansetzen, um so einen Fonds als umweltfreundliches Produkt vermarkten zu können. Zu diesem Zweck hat die EU für PAB und CTB klare Regeln formuliert: Zum einen müssen in PAB-Indizes enthaltene Unternehmen im Jahr eins mindestens 50 Prozent weniger CO2-Intensität gegenüber den Standardindizes aufweisen, die im CTB enthaltenen immerhin noch 30 Prozent. Zum anderen müssen die Unternehmen in PAB und CTB im Durchschnitt ihre Treibhausgase Jahr für Jahr um sieben Prozent reduzieren.
Zusätzlich werden bestimmte Aktien ausgeschlossen. Bei PAB sind die Ausschlusskriterien besonders streng. Die PAB schließt Unternehmen aus, die in den Bereichen Kohle und – oberhalb gewisser Umsatzschwellenwerte – Erdöl, Erdgas sowie kohlenstoffintensive Stromerzeugung tätig sind. Sowohl bei PAB als auch bei CTB bleiben außerdem Unternehmen außen vor, die ihr Geld mit Tabakwaren oder kontroversen Waffen verdienen, ebenso wie Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen, den Pakt zwischen Uno und Unternehmen zur sozialeren und ökologischeren Gestaltung der Globalisierung.
Starke Vorgaben
Hintergrund ist das sogenannte Do-No-Significant-Harm-Prinzip (DNSH): Unternehmen dürfen gegen bestimmte Grundsätze nicht verstoßen, und zwar gegen Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung und Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Nicht zuletzt müssen über die Zeit auch die sogenannten Scope-3-Daten (indirekte Emissionen, etwa durch Geschäftsreisen oder durch gekaufte Waren und Dienstleistungen) berücksichtigt werden.
Neu an den EU-Benchmarks ist die Zukunftsorientierung: „Bisher konzentrierten sich Benchmarks für eine kohlenstoffarme Wirtschaft hauptsächlich auf die Reduzierung oder den Ausschluss fossiler Brennstoffe. Die Risikobewertung basierte auf historischen CO2-Emissionen“, erläutert Emittent Franklin Templeton. Im Gegensatz zu diesem rückwärtsgerichteten Ansatz ziele die Philosophie der neuen EU-Klimareferenzwerte darauf ab, durch eine Szenarioanalyse auf Grundlage innovativer ökologischer und wissenschaftlicher Datensätze auch potenzielle Wachstumschancen zu ermitteln – ein vorwärtsgerichteter Ansatz.
Laut Franklin Templeton bieten die EU-Klima-Benchmarks dadurch ein einfaches und effektives Instrument, um sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zu orientieren. Ein wesentlicher Punkt des Konzepts ist allerdings, dass die Benchmarks nur Mindestvorgaben sind, die Fonds und ETFs erfüllen müssen, wenn sie sich mit dem Etikett PAB oder CTB schmücken wollen. Die Benchmarks definieren lediglich den Rahmen für die Einzeltitelauswahl, legen aber nicht genau fest, in welche einzelnen Aktien oder Anleihen ein ETF zu investieren hat.
Im ETF-Bereich werden in der Praxis oft Standardindizes an die PAB- und CTB-Vorgaben angepasst. So hat der Indexanbieter MSCI schon PAB- und CTB-Versionen seines beliebten MSCI-World aufgelegt. Auch andere Indexanbieter wie FTSE-Russell, Qontigo (Stoxx-Indizes), Morningstar und S&P-Dow-Jones sind mit an den Benchmarks orientierten Indizes auf dem Markt. Ebenfalls im Angebot sind auch Kombinationen der strengen SRI-Indizes von MSCI mit den PAB-Kriterien.
Beim Vergleich des klassischen MSCI-World mit der „PAB-Version“, dem MSCI-World-Climate-Paris-Aligned, zeigt sich: Die Anzahl der Indexkomponenten schrumpft deutlich: So enthält der Original-
MSCI-World-Index 1546 Aktien. In der PAB-Version des Weltindex finden sich dann jedoch nur noch 655 Titel. Bei der Branchengewichtung sind ebenfalls Unterschiede sichtbar. Der MSCI-World-
Climate-Paris-Aligned-Index gewichtet den IT- und den Finanzsektor stärker. Energietitel und Versorgeraktien kommen dagegen auf geringere Gewichte.
Bislang höhere Rendite
Mit Verzicht in Sachen Rendite geht die Ausrichtung an den EU-Benchmarks übrigens nicht einher, im Gegenteil. Die Rendite des MSCI-World-Climate-Paris-Aligned-Index lag in den Jahren 2019, 2020 und 2021 sogar über der Rendite des Standardindex. Eine Gewähr für die Zukunft ist das bessere Abschneiden in der Vergangenheit aber natürlich nicht. Die PAB-ETFs sind schließlich noch relativ jung, sodass ein abschließendes Urteil bislang nicht möglich ist.
Die Fonds-Rating-Agentur Morningstar hat schon im vergangenen Herbst ETFs mit PAB und CTB als Benchmark unter die Lupe genommen und überprüft, welche von ihnen auch die von Morningstar vergebene Low-Carbon-Kennung erhalten können. Damit kennzeichnet die Rating-Agentur Fonds mit niedrigem CO2-Risiko und wenig Engagement in fossilen Brennstoffen. Von den damals angebotenen 30 europäischen PAB- und CTB-ETFs erreichten zehn die Low-Carbon-Kennung. „Die auf den EU-Klima-Benchmarks aufsetzenden ETFs haben ein niedrigeres CO2-Risiko als ihre Vergleichsgruppen und ihr Engagement in fossilen Brennstoffen liegt deutlich unter sieben Prozent“, resümiert Morningstar-Analystin Sara Silano. Sie erwartet, dass weitere ETFs auf EU-Klima-Benchmarks eine Low-Carbon-Kennung erhalten werden.
Zunehmen dürften auch das Angebot an ETFs mit PAB und CTB als Benchmark sowie die Kombination unterschiedlicher Messlatten. Amundi hat zum Beispiel im September 2021 einen ETF auf den Markt gebracht, der sogar noch über die PAB-Anforderungen hinausgeht: den Amundi MSCI-World-Climate- Paris-Aligned-PAB-Umweltzeichen-ETF. Das ist der erste Klima-ETF, der sich nicht nur mit dem PAB-Siegel schmücken kann, sondern zusätzlich noch mit dem auch in Deutschland beachteten österreichischen Umweltzeichen.
Interview Marcus Weyerer
›› Besser als der Gesamtmarkt ‹‹
Der ETF-Spezialist von Franklin Templeton erklärt, warum nachhaltige ETFs zu den
erfolgreichsten Strategie-ETFs zählen und was sie von traditionellen ETFs unterscheidet
Jedes Jahr fließt mehr Geld in ETFs mit nachhaltigem Fokus.Wieso sind nachhaltige ETFs so gefragt?
ESG-ETFs passen zu den Überzeugungen vieler Anleger und bieten ihnen einen doppelten Nutzen: Sie können damit ihr Geld gezielt für den Erhalt der Umwelt und eine gerechtere Welt einsetzen und gleichzeitig Rendite erzielen. Stark vereinfacht erklärt, konzentrieren sich ESG-ETFs auf Investments in Unternehmen mit guter Öko- und Sozialbilanz und verzichten auf Werte mit kontroversen bzw. nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen. Das Schöne daran: In nachhaltig ausgerichtete ETFs zu investieren, bedeutet häufig keinen Verzicht auf Rendite. Im Gegenteil: Obwohl es gar nicht das primäre Ziel der ESG-ETFs ist, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, entwickeln sich manche sogar besser als der Gesamtmarkt.
Haben Sie ein Beispiel für so einen Überflieger?
Unser Franklin-S&P-500-Paris-Aligned-Climate-ETF schaffte im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs in Euro von 45 Prozent. Das waren ungefähr drei Prozent mehr als beim original S&P-500-Index. Die Quintessenz ist, dass Anleger nachhaltig investieren können und hier nicht mehr auf Nischenmärkte angewiesen sind, sondern breit diversifiziert bleiben.
Was macht dieser ETF anders?
Bei diesem Aktien-ETF steht der Klimaschutz im Vordergrund, aber auch andere nachhaltige Aspekte werden berücksichtigt. Das Portfolio wird auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 abgestimmt. Es geht also in erster Linie darum, den Temperaturanstieg zu begrenzen und den Ausstoß von Kohlenstoff zu senken. Das Portfolio wird dabei nach den Vorgaben der EU Paris Aligned Benchmark zusammengestellt. Das heißt nicht, dass die EU genau festlegt, in welche Aktien der ETF investiert, aber sie hat verschiedene Mindeststandards definiert, die der ETF erfüllen muss. Unter anderem muss der CO2-Fußabdruck des ETF-Aktienkorbs mindestens 50 Prozent unter dem Abdruck des Mutterindex liegen und der ETF darf keine Aktien von Kohleproduzenten enthalten.
Ist dieser ETF erfolgreich, weil er auf Klimasünder verzichtet?
Weyerer: Der Ausschluss bestimmter Werte ist ein Element der Strategie. Die Aktien im Portfolio werden aber auch anders gewichtet als in klassischen Indizes. Dort erhalten Aktien ja ein umso größeres Gewicht, je höher ihre Marktkapitalisierung ist. Bei Paris-Aligned-ETFs werden dagegen Unternehmen stärker gewichtet, die sich besonders gut auf den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft vorbereiten. Das ist auch eine EU-Vorgabe. Sie will damit Unternehmen anregen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Wie sich das im Einzelnen auf die Rendite auswirkt, lässt sich natürlich erst im Nachhinein sagen. Für viele Anleger macht so ein Ansatz aber intuitiv auch ökonomisch Sinn.
von Anna-Maria Borse, März 2022, © ETF Magazin
Der Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des ETF Magazins, dem Fachjournal für Profis und informierte Anleger*innen.
Weitere Artikel dieses Kolumnisten
| Uhrzeit | Titel |
|---|