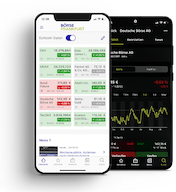Aus dem ETF Magazin: "Umstrittene Alternative Uran"

Für Deutschland ist Kernenergie keine Option. Doch viele andere Staaten setzen auf Atomstrom, um ihre Klimaziele zu erreichen. Zahlreiche Unternehmen arbeiten an neuen Technologien und in der Uranproduktion, wie das ETF Magazin berichtet.
22. November 2022. MÜNCHEN (ETF Magazin). Angesichts der ehrgeizigen Klimaziele prüfen jetzt viele Staaten alle Optionen für die nächste Generation der Energieerzeugung. Das wird nicht leicht: Bis zum Jahr 2050 dürfte der weltweite Energieverbrauch um 50 Prozent ansteigen, schätzen die Analysten der U.S. Energy Information Administration. Gleichzeitig sollen nach den Beschlüssen der Pariser Klimakonferenz jedoch die Kohlenstoffemissionen ab 2050 auf Netto-Null sinken, es sollen also genauso viele Emission abgebaut wie verursacht werden. Um diese Herausforderung zu meistern, setzen viele Staaten vor allem auf erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie, Doch auch die Kernenergie dürfte künftig im globalen Energiemix eine wichtige Rolle spielen, selbst wenn Deutschland ab 2023 vollständig auf Atomstrom verzichten will.
Andernorts wird Kernenergie jedoch häufig als sauber, zuverlässig und ja, auch als sicher betrachtet. Es lässt sich beobachten, dass die Kernenergie ihr Stigma allmählich ablegt, unter anderem aufgrund der inzwischen erreichten erheblichen Verbesserungen bei der Technologie und den Sicherheitsmaßnahmen. In dem Maße, in dem die Kernenergie an Akzeptanz gewinnt, steigt unserer Meinung nach auch das Investitionsprofil von Uran, dem Hauptbrennstoff der Kernenergie.
Den weltweit wachsenden Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, stellt die politischen Entscheidungsträger vor große Herausforderungen. Erschwerend kommt hinzu, dass 55 Prozent der Weltbevölkerung, die in dicht besiedelten städtischen Gebieten leben, mit Strom versorgt werden müssen. Bewährte erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie werden zwar immer wirtschaftlicher, doch ihr größerer Fußabdruck, die unregelmäßige Stromerzeugung und die Schwierigkeiten der schnellen Skalierung erfordern andere saubere Lösungen, um den weltweiten Energiemix zu diversifizieren. Kernenergie könnte die Lösung sein, da sie eine saubere, leistungsstarke und zuverlässige Energiequelle darstellt.
Zuverlässiger Lieferant
Ähnlich wie bei Solar- und Windenergie entstehen bei Kernspaltungsreaktoren während des Betriebs keine Treibhausgasemissionen. Aber selbst wenn man die gesamten Kohlenstoffemissionen berücksichtigt, beispielsweise die beim Bau eines Kernkraftwerks anfallenden Emissionen, gibt es bei der Kernenergie in der Regel weniger Kohlenstoffemissionen als bei anderen erneuerbaren Energien. Kernenergie ist auch zuverlässiger als andere Energiequellen. Erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie sind von variablen Klimabedingungen abhängig, um ihre Paneele und Turbinen mit Energie zu versorgen, und können zu vielen Zeitpunkten des Tages und des Jahres nicht viel Energie produzieren. Diese intermittierenden Ausfälle erschweren es, Sonnen- und Windenergie als einzige Lieferanten für den Strombedarf eines Landes einzusetzen. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration (EIA) ist die Kernenergie dagegen in 93,5 Prozent der Zeit voll ausgelastet und damit die mit Abstand zuverlässigste Energiequelle.
Auf der Suche nach sauberer Energie konzentrieren sich im Bereich der Kernenergie die jüngsten staatlichen Initiativen auf drei Hauptbereiche: die Entwicklung mehr oder weniger fortschrittlicher, bedarfsgerechter Reaktoren, die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Anlagen und drittens den Bau herkömmlicher Reaktoren.
Ein Hauptvorteil der neuesten Reaktortechnologie besteht darin, dass die Reaktoren so konzipiert werden können, dass sie den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht werden, dass also beispielsweise der Wasserverbrauch sehr gering ausfällt. Darüber hinaus sind die Investitionskosten moderner Reaktoren in absoluten Zahlen niedriger als bei herkömmlichen Reaktoren. Zudem können sie mit anderen Energiequellen kombiniert werden und sie verfügen über eine bessere Sicherheitsausstattung.
Kleine Modulreaktoren (SMR) sind das bekannteste Beispiel für diese neuen Reaktortypen. SMR haben alle Vorteile herkömmlicher Kernkraftwerke, erfordern aber weniger Planung und Kapitalbedarf als ihre traditionellen Gegenstücke. Dadurch eignen sie sich besonders für kleinere Energieprojekte. Der weltweit erste aktive SMR ist ein schwimmender Lastkahn in der Arktis, der die russische Stadt Pevek mit Strom versorgt. Dieser Reaktor zeigt die Einsatzmöglichkeiten der SMR-Technologie, insbesondere in ländlichen Gebieten. Derzeit gibt es in 17 Ländern mehr als 70 SMR-Konzepte in verschiedenen Entwicklungsstadien.
Einsatzzeit ausdehnen
Die Verlängerung des Lebenszyklus eines bestehenden Kernkraftwerks ist eine weitere Option, da dies deutlich weniger kapitalintensiv ist als der Bau eines neuen Kraftwerks. Wichtig ist auch, dass Anlagen mit verlängerter Lebensdauer in Bezug auf die Kosten mit kohlenstoffarmen Technologien wettbewerbsfähiger sind. Die Vereinigten Staaten verfügen über einige der ältesten Kernreaktoren der Welt, mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Schätzungsweise 90 Prozent der US-Kernkraftwerke haben in den letzten Jahrzehnten eine Verlängerung ihrer Betriebsdauer von 20 auf 40 Jahre erhalten. Vor Kurzem hat die Atomaufsichtsbehörde (NRC) damit begonnen, die Lizenzen zu verlängern und den Anlagen eine potenzielle Lebensdauer von 80 Jahren zu geben. Mehr als 20 Prozent der Kernreaktoren in den Vereinigten Staaten haben nun solch eine lange Nutzungsdauer.
In den Entwicklungsländern ist die Zustimmung zur Kernenergie noch ausgeprägter. Asien ist ein führendes Zentrum für den Bau neuer Reaktoren. In China sind 18 traditionelle Reaktoren im Bau, in Indien sechs und in Südkorea vier. Weltweit sind über 50 Reaktoren in 19 verschiedenen Ländern im Bau, das entspricht einer Zunahme von mehr als zehn Prozent, denn weltweit sind aktuell 445 Reaktoren in Betrieb.
Uran liefert den Brennstoff für Kernkraftwerke. Doch viele der weltweit größten Uranförderer, darunter Cameco und Kazatomprom, drosselten ihre Produktion oder schlossen ihre Minen ganz, als die Weltwirtschaft zu Beginn der Pandemie zum Stillstand kam. Das führte dazu, dass der Markt, der zu Beginn der Pandemie ein starkes Überangebot aufwies, heute ein Angebotsdefizit zeigt. Da jetzt die Urannachfrage wieder steigt, wird sich das Angebotsdefizit wahrscheinlich nicht bald auflösen.
Angebotsdefizit stützt Uranpreise
Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen ist bei Uran ein längerer und umfangreicherer Produktionszyklus erforderlich. Versorgungsunternehmen müssen Uran zwölf bis 24 Monate vor der erwarteten Verwendung beschaffen. Produzenten wie Cameco und Kazatomprom, die zusammen 28 Prozent der weltweiten Uranproduktion im Jahr 2020 ausmachten, werden ihre Produktion voraussichtlich erst in den nächsten ein bis zwei Jahren steigern. Dieser Zeitplan lässt vermuten, dass wir frühestens zwischen 2024 und 2026 mit einer wesentlich höheren Produktionsleistung rechnen können – was die Preise unterstützen dürfte.
Der Markt für börsengehandelte Fonds signalisiert ebenfalls eine steigende Uranpreisdynamik, ebenso wie das Investitionsverhalten institutioneller Anleger. Uran unterscheidet sich von anderen Energierohstoffen wie Öl und Erdgas dadurch, dass sein Terminmarkt relativ unterentwickelt ist. Daher suchen die meisten Anleger ein Engagement in Uran nicht über den Terminmarkt, sondern eher über börsengehandelte Fonds, einzelne Aktien oder Käufe am Spotmarkt. Schon im vergangenen Jahr stiegen in den Vereinigten Staaten die Mittelzuflüsse in die dort verfügbaren vier Uran-ETFs rapide an.
Käufer außerhalb des Finanzbereichs, also beispielsweise Stromversorger, bringt die Kaufaktivität auf dem physischen Markt in eine schwierige Lage. So hat beispielsweise ein neuer physischer Uranfonds zwischen Juli und Ende Dezember 2021 etwa 44 Millionen Pfund (lbs) Uran gekauft im Wert von etwa zwei Milliarden Dollar. Allein dieser Kauf entsprach einem Viertel des Welt-Uranbedarfs 2021 von schätzungsweise 180 Millionen Pfund. Die Käufe des Fonds trugen dazu bei, dass der Uran-Spotpreis seit Anfang 2021 von 30 Dollar pro Pfund auf heute rund 50 Dollar pro Pfund anstieg.
Dieser Preisauftrieb wird die Versorgungsunternehmen wahrscheinlich dazu zwingen, eher früher als später über eine Neuvergabe von Verträgen nachzudenken, um größere Preisauswirkungen zu vermeiden. Versorgungsunternehmen halten in der Regel nur einen Bestand von zwei bis vier Jahren vorrätig. Wenn sie jetzt mit der Neuvergabe warten, laufen sie Gefahr, dass die Preise weiter steigen und sie noch mehr bezahlen müssen. Ein möglicher Preisrückgang könnte aber auch für diese Versorgungsunternehmen von Vorteil sein.
Positives Momentum
Wir sind der Meinung, dass die anhaltende politische Zustimmung und finanzielle Unterstützung dafür sorgen, dass die Kernenergie auf Dauer Bestand haben wird, insbesondere weil die Nachfrage nach sauberer und zuverlässiger Energie steigt. Im Jahr 2021 hat ein breiterer Kreis von Investoren der Kernenergie und der Rolle, die sie bei der Erreichung der weltweiten Klima-ziele spielen kann, große Aufmerksamkeit geschenkt. Der starke Anstieg des Uranpreises hob auch die Kurse der Uranaktien um rund 60 Prozent. Wenn die Entwicklung anhält, könnte sie die Tür für eine Aufnahme von Uran in breiter angelegte Indizes öffnen und damit die Kurse weiter unterstützen. In Deutschland erhalten Anleger diversifizierten Zugang zur Branche beispielsweise durch unseren Uranium-ETF (ISIN: IE000NDWFGA5). Dieser seit Ende April an Xetra gehandelte ETF enthält 50 Aktien von Unternehmen, die sich mit der Uranförderung oder der Produktion von Nuklearkomponenten beschäftigen.
von Rohan Reddy, 18. Oktober 2022, © ETF Magazin
Der Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des ETF Magazins, dem Fachjournal für Profis und informierte Anleger*innen.
Weitere Artikel dieses Kolumnisten
| Uhrzeit | Titel |
|---|