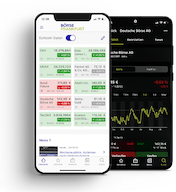pfp Advisory: "Im Koalitionsvertrag fehlt mir das Vertrauen"

Fondsmanager Christoph Frank setzt sich mit dem Abkommen der neuen Regierung auseinander – welche Effekte er für Unternehmen und die Wertpapiermärkte heraus liest.
26. Mai 2025. FRANKFURT (pfp Adisory): „Was erwartest du in Sachen Börse eigentlich von der neuen Regierung?“, wurde ich am Wochenende kurioserweise gleich zweimal in ganz unterschiedlichen Situationen gefragt. Grund genug, mich einmal etwas intensiver mit dem Koalitionsvertrag auseinanderzusetzen. Denn schließlich soll dieses Dokument Leitlinie für politisches Handeln in den kommenden Jahren sein. Leider bestätigte sich beim Querlesen meine grundsätzliche Skepsis, dass dieser Koalitionsvertrag wirklich spürbar besser für die deutsche Börse wirken könnte als der Vertrag der Ampel-Regierung.
Erste Aufwärmübungen: Das Wort „Börse“ findet sich auf den 146 Seiten genau einmal; aber nicht etwa im „klassischen Sinne“ als Wertpapierhandelsplatz, sondern im Wort „Tierbörse“ (kein Scherz). Für „Aktie“ gibt es ebenfalls einen Treffer; aber auch hier in einem eher abseitigen Zusammenhang, nämlich mit dem „aktienrechtlichen Beschlussmängelrecht“. „Kapitalmarkt“ kommt immerhin achtmal vor, allerdings – ebenfalls kein Scherz – viermal in den Abschnitten „Kapitalmarktregulierung“ und „Regulierung Kryptowerte, Grauer Kapitalmarkt und Schattenbanken“. Ich verstehe jeden Kapitalmarktakteur, der schon jetzt keine Lust mehr hat, weiterzulesen.
Auch ansonsten liest sich das Werk leider selten besser als befürchtet. Immerhin: Ein paar Abschnitte sind konstruktiv, und insgesamt kündigt die neue Koalition zum Thema „Wirtschaft“ deutlich mehr an als die Ampel in deren Vertrag. Die üblichen guten Vorsätze zum Bürokratieabbau nehme ich ehrlich gesagt nurmehr achselzuckend zur Kenntnis, finden sie sich doch ausnahmslos in jedem Koalitionsvertrag der vergangenen 25 Jahre, und das stets mit einem eigenen Kapitel. Und ja, das habe ich höchstselbst nachgeprüft. Ernst nehme ich das Ganze erst, wenn ich Taten sehe, und da scheint mir der Elan, da wir jetzt nach der Ankündigungsphase in die Umsetzungsphase kommen, schon wieder merklich gebremst (z. B. fehlende Strukturreformen und „EU-Lieferkettengesetz“). Allein die Tatsache, dass der Bürokratieabbau auch im neuesten Koalitionsvertrag angekündigt wird, zeigt, wie phrasenhaft und wirkungslos alle vorherigen Ankündigungen waren. Heute haben wir nicht weniger Bürokratie als zur Jahrtausendwende, sondern erheblich mehr.
Am meisten stört mich aber, dass im Koalitionsvertrag etwas Grundsätzliches fehlt: ein Vertrauensvorschuss des Staates in den Bürger und die Unternehmen. Zwar steht an einer Stelle der schöne Slogan „Vertrauen statt Regulierung und Kontrolle“, doch leider bezieht er sich nur auf gewisse Dokumentationspflichten für bestimmte Branchen. Ich würde mir wünschen, die Koalitionäre hätten diesen blumigen Sonntagsvorsatz viel weiter gefasst. Denn nicht nur die Marktwirtschaft und der Kapitalmarkt funktionieren erheblich besser, je mehr Menschen und Staatsorgane einander vertrauen, sondern auch die Demokratie und Zivilgesellschaft insgesamt.
Eine von Vertrauen geprägte Politik würde auf Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft von Bürgern und Unternehmen setzen, statt ihnen kleinteilige Vorschriften zu machen und vorzugeben, sie vor allen möglichen Risiken zu „schützen“. Im Vordergrund sollte die Frage stehen, ob ein Gesetzentwurf wirklich nötig ist, oder das gewünschte Ziel nicht besser ohne Regulierung und mit einer besseren Anreizsetzung erreicht werden könnte. Beispielsweise könnte der Staat vorgeben, dass schädliche Klimagase reduziert werden müssen, und dafür den Ausstoß mit einem Preisschild koppeln. Im Anschluss lässt er Bürger und Unternehmen entscheiden, wie sie die Vorgaben konkret umsetzen. Der eine wird sich vielleicht für eine bessere Dämmung entscheiden, die andere für eine Wärmepumpe, die dritte vom Benziner ins E-Auto umsteigen.
Eine ähnliche Technologieoffenheit sollte der Staat auch den Unternehmen ermöglichen und von einer planwirtschaftlichen „Industriepolitik“ absehen. Kein Zentralplaner und keine Ministerin kann wissen, welche Technologie sich durchsetzen wird und warum gerade Chipfabrik X mit Milliardenbeträgen gefördert werden muss oder und nicht etwa Y. In einer Marktwirtschaft werden das die Unternehmen sehr viel effizienter herausfinden, und gute Unternehmen kommen in der Regel ohne Subventionen aus. Man muss sie nur machen lassen und ihnen und ihren Mitarbeitern das nötige Vertrauen schenken. Der Staat sollte den allgemeinen Rahmen (m. E. bevorzugt pauschal und ohne kleinteilige Einzelfallvorschriften) abstecken sowie für Rechtssicherheit, klare Regeln und deren Durchsetzung sorgen. Im Gegenzug für mehr Vertrauen kann er härtere Strafen bei Fehlverhalten verhängen. Letzteres gilt übrigens auch für den Kapitalmarkt (Stichworte Cum-Ex, Cum-Cum und andere Unappetitlichkeiten).
Eine solche Vertrauenskultur hat (West-)Deutschland schon einmal stark gemacht und u. a. das „Wirtschaftswunder“ nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs möglich gemacht, was den Wohlstand für (fast) alle erhöht und nebenbei auch für steigende Aktienkurse gesorgt hat. Es geht also – und würde dem Titel des Koalitionsvertrags „Verantwortung für Deutschland“ wesentlich besser gerecht werden.
Von Christoph Frank, 26. April 2025, © pfp Advisory
Über den Autor
Christoph Frank ist geschäftsführender Gesellschafter der pfp Advisory GmbH. Gemeinsam mit seinem Partner Roger Peeters steuert der seit über 25 Jahren am deutschen Aktienmarkt aktive Experte den DWS Concept Platow (WKN DWSK62), einen 2006 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds, sowie den im August 2021 gestarteten pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium (WKN A3CM1J). Weitere Infos unter www.pfp-advisory.de. Frank schreibt regelmäßig für die Börse Frankfurt.

Weitere Artikel dieses Kolumnisten
| Uhrzeit | Titel |
|---|